Kulturerbe im Anthropozän: Der Nachlass extraktivistischer Städte im brasilianischen Amazonasgebiet
Von Berlin bis Detroit, von Tschernobyl bis zu abgelegenen verlassenen Fabriken in Island – die sogenannten „Ruinen der Moderne“ (Pétursdóttir, 2013) rufen Bilder von Ausbeutung, Verfall, Verlust und Verschwendung hervor. Viele dieser Orte, an denen einst Rohstoffprojekte betrieben wurden, offenbaren die Fallstricke der Moderne und das Ungleichgewicht mit der Natur. Gleichzeitig sind einige dieser Orte Ziel kontrastreicher Initiativen zur Heritagisierung und Place-Making geworden, die einen globalen Trend in der Auseinandersetzung mit der Frage offenbaren, wie an Denkmäler der Industrialisierung und ihre Auswirkungen auf die Umwelt erinnert werden soll. Sie haben auch eine akademische Debatte angestoßen, die den Platz des Kulturerbes im Anthropozän hinterfragt, da die Menschheit mit Klimakrisen, der Zerstörung von Lebensräumen und einem erheblichen Rückgang der Artenvielfalt konfrontiert ist (Harrison, 2015; Harrison und Sterling, 2020; Tornatore, 2017). Dieses Projekt reiht sich in diese Debatte ein, indem es Diskurse über das Kulturerbe im Kontext des Amazonaswaldes diskutiert, wo ehemalige Firmenstädte aus dem 20. Jahrhundert ebenfalls zum nationalen Kulturerbe erklärt werden.
Projektbeschreibung
„Making Heritage in the Anthropocene: The Afterlife of Extractivist Cities in the Brazilian Amazon” ist ein Promotionsprojekt, das Teil der von der Gerda Henkel Stiftung finanzierten Forschungsgruppe RESILIENT ist und in der Abteilung für Koevolution von Landnutzung und Urbanisierung angesiedelt ist. Das Projekt wird außerdem im Rahmen des Doktorandenprogramms des Instituts für Regional- und Stadtplanung der TU Berlin durchgeführt. Diese interdisziplinäre Doktorarbeit wird gemeinsam von Stephanie Herold, Patrick Roberts und Danielle Heberle Viegas betreut.
Dieses Projekt widmet sich der Untersuchung des Übergangs von ehemaligen Firmenstädten zu aktuellen Kulturerbestätten in zwei extraktivistischen Projekten im brasilianischen Amazonasgebiet: Serra do Navio und Fordlândia. Mit einem multidisziplinären Ansatz, der kritische Kulturerbe-Studien, Dekolonialisierungsstudien, Umweltgeschichte und Stadtgeschichte integriert, beleuchtet diese Forschung die politische Rolle, die Kulturerbe-Narrative angesichts der Herausforderungen des Anthropozäns und im Kontext des größten Regenwaldes der Welt einnehmen können.
Die Projektmethodik umfasst Archivforschung und Ethnografie sowie die Einbeziehung lokaler Gemeinschaften und institutioneller Akteur:innen durch formelle und informelle Interviews. Die Forschung ist in drei Teile gegliedert, die (1) die Entstehungs- und Verfallsgeschichte dieser Firmenstädte, (2) die institutionellen Narrative zum Kulturerbe und bestehende Gegennarrative sowie (3) die Rolle des Diskurses zum Kulturerbe in der Sozial- und Umweltpolitik der Region behandeln.
Von „Inseln der Entwicklung“ zu „Ruinen der Moderne“: Eine Diskussion über die Entstehung und den Niedergang amazonischer Firmenstädte
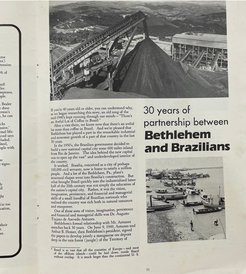
Der erste Teil der Forschung konzentriert sich auf die Geschichte dieser Firmenstädte und zeigt, wie sie sich von hoch entwickelten Zentren zu verarmten Orten entwickelten. Um eine Lücke in der bestehenden wissenschaftlichen Forschung zu schließen, wird die Geschichte dieser Städte in den Kontext der Kolonisierung des Amazonasbeckens und dessen Rolle in globalen Rohstoffketten eingeordnet. Letztendlich werden sie als Knotenpunkte innerhalb eines größeren kolonialen und neokolonialen Infrastrukturnetzwerks dargestellt. Die Analyse ihres Verfalls umfasst sowohl das Verständnis der sozio-ökologischen Schäden als auch die Auseinandersetzung mit Debatten rund um Ruinen, Ruderalerbe und das Erbe aus und innerhalb des Anthropozäns.
Ein Leben nach dem Tod als Kulturerbe: Narrative und Gegennarrative an extraktivistischen Kulturerbestätten

Der zweite Teil dieser Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der institutionellen Narrative zum Kulturerbe dieser Stätten sowie auf die Gegennarrative anderer sozialer Akteur:innen. Auf der Grundlage des im ersten Teil diskutierten theoretischen Rahmens sowie des von Laurajane Smith (2008) entwickelten Konzepts des „Authorised Heritage Discourse” werden die vom brasilianischen Institut für Nationales Kulturerbe (IPHAN) erstellten Dokumente untersucht und es werden Interviews mit Vertretern der Institution geführt. Ziel ist es, den offiziellen Diskurs zum Kulturerbe hinter dem Schutz dieser Stätten zu bewerten. Darüber hinaus werden bestehende lokale Gemeinschaften und ehemalige Bewohner dieser Firmenstädte kontaktiert, um die bestehenden Gegendarstellungen zum Kulturerbe zu bewerten. Dies ermöglicht es, die Verbindungen und Diskrepanzen zwischen dem Kulturerbe gemäß den offiziellen Institutionen und dem von den Menschen gelebten Kulturerbe zu diskutieren.
Die Arbeit mit Verflechtungen zwischen Umweltpolitik und Denkmalschutzdiskurs
Dieser Teil der Untersuchung konzentriert sich auf die Analyse der bestehenden Umweltpolitik für jede ehemalige Unternehmensregion und bewert die Herausforderungen, denen die an diese ehemaligen Rohstoffförderungsprojekte angrenzenden Schutzgebiete gegenüberstehen. Ziel ist es, zu ermitteln, wie sich potenzielle neue Rohstoffförderungsprojekte auf diese Schutzgebiete auswirken, welche Maßnahmen zur Umwelterziehung vorgeschlagen werden und ob und wie das Erbe der Unternehmensstädte bei der Festlegung dieser Bildungsmaßnahmen berücksichtigt wird. Ziel ist es, die Zusammenhänge zwischen dem offiziellen Diskurs zum Kulturerbe und der lokalen Umweltpolitik zu bewerten, um einen Weg aufzuzeigen, wie Verflechtungen positiv auf das Gebiet einwirken können. Dieses Kapitel zielt darauf ab, lokale Umwelt- und Kulturerbe-Politiken zu integrieren und so dazu beizutragen, die Kluft zwischen Natur- und Kulturerbe zu überwinden, um Wege zur Schaffung eines Kulturerbes zu finden, das zur Bewältigung des Anthropozäns beiträgt.












